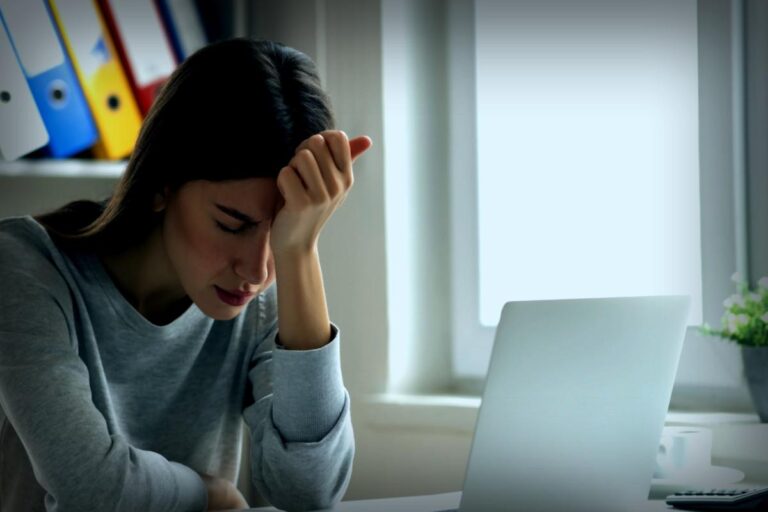Die deutsche Energiewende steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Die Regierung unter Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wagt einen Richtungswechsel. Anstelle einer stringent unnötigen Strategie zur Klimaneutralität liegt nun der Schwerpunkt verstärkt auf Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit. Dabei nimmt Erdgas erneut eine zentralle Rolle als Übergangsenergieträger ein, was vor allem für die Stromkund*innen verschiedene finanzielle Folgen mit sich bringt.
Erdgas als Schlüssel zur „Technologieoffenheit“
Der neue Zehn-Punkte-Plan von Reiche stützt sich auf den aktuellen Monitoringbericht zur Energiewende und verfolgt nun einen „pragmatischeren und realistischeren“ Ansatz zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045. Ein markanter Wandel bedeutet das Ende des bisherigen Fokus auf grünen Wasserstoff (H2) zugunsten des Einsatzes von blauem, respektive kohlenstoffarmen Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird.
Blauer Wasserstoff entsteht, indem Erdgas in Wasserstoff und Kohlendioxid (CO2) umgewandelt wird, wobei das CO2 entweder in tiefen Gesteinsschichten gespeichert (Carbon Capture and Storage, CCS) oder industriell verwendet (Carbon Capture and Utilization, CCU) wird. Wichtig ist dabei, dass das CO2 nicht in die Atmosphäre entweicht.
„Das Monitoring stellt keineswegs einen Rückschlag für die Klimaziele dar oder gibt ein Alibi zur Entschleunigung der Transformation in der Energiewirtschaft“, erklärt Prof. Dr. Gerald Linke, der Vorsitzende des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW). „Es deutet vielmehr auf einen wesentlichen Kurswechsel in der Energiepolitik hin: weg von übermäßig komplizierten Vorgaben in einer Region und Regelungsdefiziten in einer anderen, hin zu einem an der Praxis orientierten, technologieoffenen Ansatz für die Transformation der Energieberichterstattung.“
Umweltorganisationen wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sehen das jedoch anders. Die Einbindung in eine CCS-Wirtschaft sei zwar lukrativ für Öl- und Gaskonzerne, brächte jedoch für Ökosysteme, Gesundheit und Klima „unkalkulierbare und generationsübergreifende Risiken“ mit sich, schreibt die Organisation in einem Infobeitrag. Eine Untersuchung von Greenpeace bezieht sich auf die signifikanten Kosten von bis zu 81,5 Milliarden Euro, die CCS bis 2045 verursachen könnte, ohne dass es nennenswerte klimatische Fortschritte gäbe; stattdessen dürfte dies den Ausstieg aus fossilen Energieträgern aufschieben.
Ein moderner Kapazitätsmarkt
Wesentlich für diese Reform ist der geplante Kapazitätsmechanismus (KKM), der einen zweistufigen Kapazitätsmarkt schaffen soll, der kostenstabile Einnahmen für regulierbare Kraftwerke wie die erdgasbetriebenen „H2-ready“ Anlagen sichert.
- Im zentralen Kapazitätsmarkt erhalten neue Anlagen sichere Zahlungen für ihre Leistung, die durch eine neue Umlage auf den Stromrechnungen finanziert werden.
- Im dezentralen Bereich müssen Energieversorger Kapazitätszertifikate nachweisen. Dies kann entweder durch eigene Leistungen, beispielsweise über Speicher oder Lastmanagement, lukriert oder aber zukauft werden. Auch diese Kosten werden schlussendlich an die Kund*innen weitergereicht.
Ab 2026 sinkt der Gaspreis zwar etwas dank des Wegfalls der Gas-Speicherumlage, die in 35e des Energiewirtschaftsgesetzes verankert ist. Doch für die Stromkunden könnte das zu einer zusätzlichen Belastung führen: neue Umlagen holen mehr Geld aus den Taschen der Privathaushalte und Unternehmen.
Chancen und Herausforderungen des „blauen“ Wasserstoffs
Im besten Fall würde blauer Wasserstoff tatsächlich die Emissionen reduzieren, vorausgesetzt das CO2 könnte lückenlos gespeichert werden. Laut dem Weltklimarat (IPCC) ist CCS unter den richtigen Voraussetzungen wirksam, doch in Wahrheit hat sich die Technologie als teurer, umstrittener und noch relativ unbekannter Ansatz herausgestellt.
Ebenfalls problematisch sind die Methan-Emissionen in der gesamten Erdgas-Lieferkette. Ein Berichtszusammenfassung der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigt auf, dass die Emissionen aus der Öl- und Gasproduktion überwiegend auf einem Rekordniveau verharren – trotz existierender kostengünstiger Reduzierungsmöglichkeiten. Auch kleine Leckagen könnten den Klimavorteil des blauen Wasserstoffs schnell zunichte machen.

Die Herausforderungen der CO2-Abscheidung und -Speicherung schrecken viele ab. Trotz konsensfähiger Standortwahl und Überwachung gilt diese als relativ sicher, doch Unsicherheiten bleiben. Gefahren durch Leckagen über alte Bohrlöcher oder geologische Störungen könnten das Empfinden zurückgeben und den Klimavorzug binnen kurzer Zeit annulierennn. Eine dauerhafte Kontrolle wäre zudem natürlich erforderlich.
Laut der geplanten Vorgabe der Europäischen Kommission von 2025, muss sodann kohlenstoffarmer Wasserstoff mindestens 70 Prozent Treibhausgaseinsparung gegenüber fossilen bezogene Normalwerten erzielen. Ob diese Anforderungen tatsächlich eingehalten werden, erscheint垃fehlbar.
Die Realität im deutschen Netz
Die Bundesregierung möchte Ausschreibungen für bis zu 20 Gigawatt neuer steuerbarer Kapazität, hauptsächlich durch Gaskraftwerke, durchführen. Hierbei liegt die Hauptlast im Süden Deutschlands – eine Region, die sich nach dem Atom-Ausstieg und infolge bestehender Netzengpässe mit signifikanten Herausforderungen konfrontiert sieht.
Zunächst sollen diese Kraftwerke mit Erdgas betrieben werden, bevor später auf Wasserstoff umgeschwenkt werden soll. Damit dies gelingt, bedarf es allerdings stabiler Wasserstoff-Leitungen und einer robusten Infrastruktur für den Transport und die Speicherung von CO2. Ohne feste Umrüstfristen könnten diese neuen fossilen Strukturen sonst von Dauer sein.
Fakt ist: Gasunternehmen und Betreiber profitieren zugleich von jener Planung. Während die Stromkunden durch neue Umlagen und Zertifikatskosten im zentralen Kapazitätsmarkt stärker belastet werden. Die Bundesregierung verweist weiterhin auf die nötigste Versorgungssicherheit und warnt in ihrem neusten Bericht der Bundesnetzagentur, dass ohne neue steuerbare Kapazitäten das gesamte Netz an seine Grenzen stoßen könnte. Unsicherheit angesichts der bereits hohen Strompreise in Europa birgt zusätzliche Herausforderungen für die Politik.
Quellen: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; „Energiewende. Effizient. Machen. Monitoringbericht zum Start der 21. Legislaturperiode“ (EWI, 2025); Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches; Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland; Greenpeace Deutschland; Gesetze im Internet; Intergovernmental Panel on Climate Change; Internationale Energieagentur; Europäische Kommission; Bundesnetzagentur