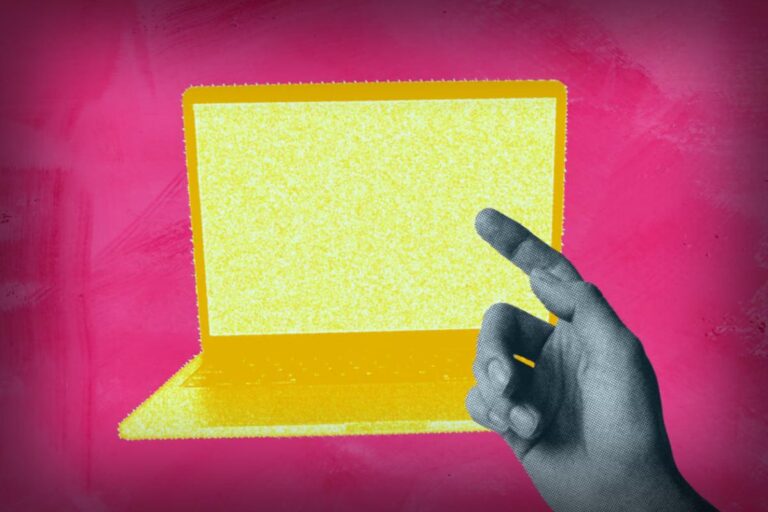Oops, um einen weiteren coup handelt es sich hier kann man sagen. Donald Trump hat mal wieder für Aufregung gesorgt, indem er 100-prozentige Strafzölle auf chinesische Importe angekündigt hat. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs: Hinter diesen Zöllen steht ein viel größeres Spiel, bei dem die US-Regierung die Grundlagen für den internationalen Handel massiv verändert.
Am 25. September hat die Trump-Administration auf die sogenannten Section 232 des Trade Expansion Act von 1962 zurückgegriffen, um eine neue Welle von Zollerhöhungen für Lastwagen, Möbel, Markenprodukte und patentierte Medikamente zu verkünden. Der Grund? Diese Importe stellen eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. Dieser Schritt untermauert das Motto von Trump: „America First“ – und das gleich zu Beginn seiner zweiten Amtszeit.
In weniger als einem Jahr hat Trump eine hochgradig protektionistische Zollpolitik eingeführt, die den durchschnittlichen Zollsatz in den USA auf etwa 18 Prozent hebt. So hoch war der Satz seit fast 100 Jahren nicht mehr, und das belastet das weltweite Freihandelsystem ganz erheblich.
Der Fokus dieser neuen Zölle liegt auf dem Ziel, die amerikanische Fertigungsindustrie wiederzubeleben. Im Pharmabereich sollen beispielsweise Zölle bis zu 100 Prozent auf alle importierten Marken- oder patentierten Arzneimittel erhoben werden. Unternehmen, die jedoch „Produktionsstätten in den USA errichten“, können sich dieses Schicksal sparen.
Die Strategie geht über klassisches Protektionismus-Denken hinaus. Trump gibt ausländischen Unternehmen ein einfaches Dilemma: Entweder sie bauen Fabriken in den USA, oder sie zahlen die 100-prozentigen Zölle. So fügt sich der Präsident direkt in die globalen Investitionsentscheidungen großer Firmen ein und zwingt sie, Jobs und Kapital zurück in die USA zu bringen.
Die Nachricht aus Washington an weltweite Player in Hochtechnologie und strategischen Industrien ist klar: Der Zugang zum US-Markt hängt nun entscheidend davon ab, ob diese Firmen Produktionsstätten in den USA etablieren.
Wenn man genauer hinschaut, entdeckt man in Trumps Zollpolitik jedoch einige paradoxe Widersprüche. Sein Team glaubt, dass baldige Zollerhöhungen die Handelsdefizite verringern, die Produktionsrückkehr forcieren, „unfaire“ Handelspraktiken angreifen und die Umsätze vonseiten des Staates zum Finanzieren von Steuersenkungen steigern. Aber das sehen etablierte Wirtschaftsexperten anders. Leitende westliche Institute ziehen die Schlussfolgerung, dass diese Zölle eher wie Steuern agieren, die die amerikanischen Verbraucher und Unternehmen belasten und die Inflation anheizen werden. Das Ergebnis? Langfristig könnten diese Maßnahmen das Wirtschaftswachstum sowohl in den USA als auch weltweit erheblich beeinträchtigen.
Wer würde überhaupt von diesen enormen US-Zöllen profitieren? Während die Regierung scheint, die Interessen der unternehmerischen Amerikaner zu vertreten, tragen letztendlich die Verbraucher die Last dieser Zölle: Sie zahlen höhere Preise, vor allem die Haushalte, die für lebenswichtige Güter ausgeben. Doch die Zölle sind direkt mit steuerlichen Vorteilen verbunden, von denen besonders die wohlhabenden Haushalte profitieren, während die Armen das größte Stück der Last tragen.
Verschiedene Länder antworten auf diese US-Politik nicht mehr gemeinsam über die WTO, sondern entwickeln individuelle „Überlebensstrategien“, die ihrer Wirtschaft Halt geben sollen – und das schwächt die kollektive Verhandlungsmacht als Verbündete erheblich. Innerhalb der trumpanischen Philosophie nimmt die wirtschaftliche Sicherheit andere Länder keine zentrale Rolle ein. Verhandlungen können jederzeit zum eigenen Vorteil des Landes personalisiert werden.
Die Handelsstrategie der USA und das beschlossene neue Status quo führen zu einer Veränderung im geopolitischen Gefüge. Die seit dem Zweiten Weltkrieg bestehende westliche Allianz, konsultativen Erbschaft durch ideologische Veranlagungen, steht zur Disposition. Alte Beziehungen wie die transatlantischen Prozesse zeigen Konturen von Brüchen, und die USA beginnen, einen eigenen erkennbaren Isolationismus mit ihren wirtschaftsstrategischen Zügen für alle sichtbar zu erheben.
Wir müssen die Botschaft verstehen: Trumps Politik enthält keine kurzfristige Abweichung des Handelssystems, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert hat. So strebt die aktuelle US-Regierung wie für selbstverständlich gleichzeitig eine De-gradierung und, im Bedarfsfall, den Umbau eines globalen Handelsnetzes bezüglich amerikanischer Präferenzen an.
An dieser Differenzierung und in dieser kritischen Phase ist es essential, unser multilaterales Anspruchsmodell des bemerkenswert offenen Handels im Interessen einer stabilen Weltwirtschaft und gemeinsamer Governance zu verteidigen—indem wir straffe und alternative Regelstrukturen etablieren.
Professor Gao Jian ist Direktor des Centre of Sino-Britain People-to-people Dialogue an der Shanghai International Studies University und Senior Researcher am China Forum an der Tsinghua University.