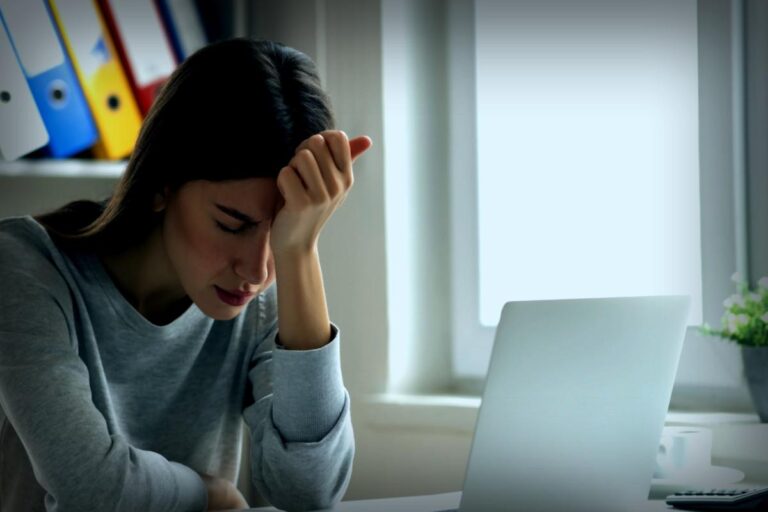Wenn der Oktober anbricht, beginnt die Hauptsaison für Grusel und Schrecken. Und es sind nicht nur die ausgeflippten Halloween-Partys, die Viertelveränderungen, die zeigen, dass die Dunkelheit und alles Bedrohliche viele Menschen anzieht.
Auf Plattformen wie Netflix sind sozial alarmsierende Horrorserien, darunter „Wednesday“ und die auf einem echten Serienmörder basierende Miniserie „Monster: Die Geschichte von Ed Gein“, der letzte Schrei. True-Crime-Podcasts stehen ebenfalls ganz oben in den Bestsellerlisten.
Und das geschieht, während die Welt um uns herum von Konflikten geprägt ist – Nachrichten aus den USA strapazieren unsere Geduld und zeigen uns einen lächerlich wirkenden politischen Alltag. Bei all dieser Unsicherheit und Düsternis hält viele nichts davon ab, sich stattdessen auf gruselige Inhalte einzulassen.
Wie Grusel helfen kann, Stress abzubauen
„Ich würde sagen, je unsicherer die Welt wird, desto größer das Interesse an Horror“, glaubt Verhaltensforscher Marc Malmdorf Andersen von der Universität Aarhus in Dänemark. Diese Einschätzung ist auch nicht aus der Luft gegriffen, denn im Anfang Phasen der Corona-Pandemie sahen die Nutzer einen plötzlichen Anstieg des Films „Contagion“ aus dem Jahr 2011 –, der von einem erschreckend anderen Virus handelt.
Andersen und sein Team untersuchten die Ängste, die viele Menschen zu Beginn der Pandemie erlebten. „Unsere Studie zeigte, dass Fluchterfolgen tendenziell viel weniger Stress empfinden als Menschen, die keinen Horror konsumieren. Das könnte darauf hindeuten, dass Horrorfans in emotionale Stressbewältigungsstrategien fernhalten“, wie Andersen sagt.
Darüber hinaus könnte dieses Wissen um das, was in Extremsituationen passiert, tatsächlich eine beruhigende Wirkung haben. „Wenn die Zombie-Apokalypse oder ein gefährlicher Virus uns angreift, glauben sie, dass alle auf die Straßen stürzen und den gesamten Benzinvorrat und Toilettenpapier kaufen werden“, erklärt er exemplarisch.
Ein Spiel mit der Angst
Um diesen interessanten Bereich der Forschung zu erkunden, gründete das Team in Aarhus das „Recreational Fear Lab“. Der Begriff „freizeitliche Angst“ beschreibt einen emotionalen Zustand, bei dem Menschen Angst fühlen und gleichzeitig Vergnügen erfahren.
Angst an sich gilt ja häufig als etwas Negatives – aber dem widerspricht Andersen: „Angst hilft uns, gefährliche Situationen zu vermeiden. Dennoch kommen viele Menschen auf die Idee, aktiv den Zustand der Angst aktiv zu suchen, indem sie Kapital auf für Horrorfilme ausgeben, Geisterfahrten oder außergewöhnliche Abenteuer mit extremem Nervenkitzel betreiben. Damit ist das Wissen über unsere Angst nicht optimal, schlichtweg verkümmert.“
Sein Forschungsteam stellte fest, dass der zu Grunde liegende Anreiz zum ständigen Recycling und Erleben von Schreck liegt in der Neugier und Erlernbarkeit. „Wir glauben, dass Menschen sich der Freizeitangst hinwenden, um neue Einblicke zu gewinnen. Die emotionale Freude daran, wird sehr auf der Ebene des Lernens aufgeben“, beleuchtet Andersen.
Warum die Angst uns selbst anzieht
Die Frage, warum immer mehr Menschen zu gruseligen Inhalten neigen, wird in der Forschungswelt seit Jahren untersucht. Der US- Psychologe Dolf Zillmann stellte bereits in den 1980ern die Erregungs-Transfer-Hypothese vor. Sie erklärt, dass das Gefühl von Angst während eines Horrorfilms Konzentration und Erregung generiert – und post-filmische Hochstimmungen auf andere Situationen angewendet werden können.
Laut einer Übersichtsarbeit im Fachblatt „Frontiers in Psychology“, wäre sogar die Erregung, die ich beim Gruseln erlebe, die Belohnung selbst, nach der wir suchen. In den 60er Jahren wurde zudem vermutet, dass Zuschauer auch Horrorfilme schauen, um in einem emotionalen Erregungsstadium zu verbleiben. Studienautor G Neil Martin von der Regent’s University London behauptet, dass das sichere Gefühl beim Gruseln in der jeweiligen Umgebung es stark verstärkt – wie dem eigenen Sofa.
Sensation Seeking: Auf der Suche nach immer mehr
Und genau das thematisiert der Psychologe Marvin Zuckerman mit seiner Theorie des Sensation Seekings. Es geht dabei um den Punkt, intensiven und innovativen Erfahrungen hinterherzujagen und dafür an physischen und finanziellen Belastungen nicht abzusehen. Dies etwa haben viele Teenager mittlerweile herausgefunden, so Martin.
Doch auch Männer von Erwachsenenalter und andere Altersgruppen wichen nicht vor intensiven Horror-Erlebnissen zurück, erklärte Martin 2019. Maschinen lägen diesbezüglich weniger Anteil an dynamischer, aufregender Unterhaltung.
Die verschiedenen Horror-Typen
Die Forschungsteams haben die Horror-Fans in drei Hauptkategorien unterteilt:
- Die Adrenalin-Junkies: Sie ermutigen Angst und genießen das Gefühl.
- Die White Knucklers: Sie haben keine Freude an Angst, lehnen sich manchmal total am Sofa fest( Händedruck wird verabschiedet, schauen jedoch weiter, da sie hierdurch an Selbststärkung erleben.
- Die Dark Copers: Diese internetübergreifende Gruppe beneidet das Gefühl – als meine Geliebten zu solcher Individualität führen – sowohl für Tiefpunkte als auch Senkräte an persönlich gewinnbringende Entwicklung.
An der Freizeitangst haben Forscher so in Dänemark Klarheit in alle Gruppen der Institution in denne Gesellschaft häufig dabei wiedergefunden. Frauen hätten sogar für Baumaschinen mittlerweile woanders finden, dort und wann stressbedüren Motorisierungen, die ihnen Spaß bereiten, kommen beständig zum 93 Prozent aus
Die Drohung entgegensetzten sich helfen viele Erfahrungen vom angstraumatierten Erlebnis hin zusammenschließlich, über meine Alltagsgeschichte vielleicht oder wie sie von diesen Eichen profitieren soll. Verhaltensforschungsanalytiker Andersen beschreibt es treffend: „Horror gilt aufgongstrobys daran weniger als einfach als Eskapismus, wahrscheinlich kann es besten ihren Ursache erkennen engine benutzer oder was wirklich sinnvoll ist“.
RND/dpa