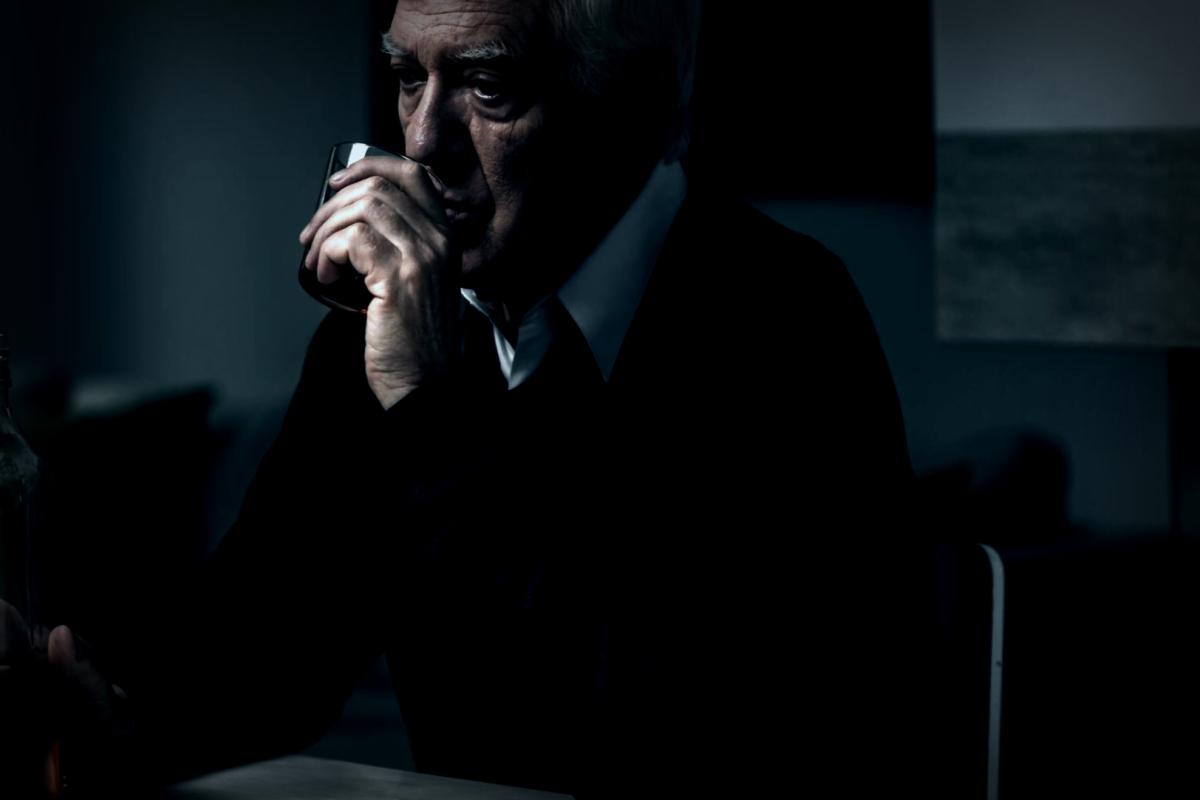Ein Glas Wein zum Abendessen, ein Bier beim Fußball oder ein Schnaps zur Verdauung – viele Senioren haben ihre Routinen, ohne sie wirklich zu hinterfragen. Laut Dirk K. Wolter, Fachmann für Geriatrie und Psychotherapie, ist regelmäßiger Alkoholkonsum für viele zwischen 60 und 75 Jahren zum Lifestyle geworden.
Ein ernstes Problem: 400.000 Senioren als Risikogruppe
Die Ehrentasse oder das gelegentliche Feierabendbier sind oft der Anfang von etwas Gefährlichem. Eine Umfrage des Robert Koch-Instituts zeigt, dass etwa 18 % der Männer und 12 % der Frauen ab 65 Jahren in riskanten Mengen Alkohol konsumieren. Schätzungen der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) sprechen von rund 400.000 Senioren, die entweder Alkohol missbräuchlich konsumieren oder süchtig sind.
Die Ursachen sind vielfältig. Wolter betont, dass es nicht nur Einsamkeit und Depression sind, die zu diesem zunehmenden Problem führen. Vielmehr liegt er den Ursprung in der gesellschaftlichen Entwicklung. Der Wohlstand der Nachkriegszeit führte dazu, dass das Trinken zu einem Teil des Lebensstils wurde.
Festgefahrene Gewohnheiten
Früher leicht erhältliches Bier, Schnaps und Wein fanden schnell ihren Platz im Alltag. Wenn man einmal in der Gewohnheit ist, wird es immer schwerer, daran etwas zu ändern, besonders im Alter. Dazu fehlen oft die äußeren Anreize, die einen zum Verzicht bewegen könnten – etwa die Verantwortung für einen Job oder das Fahren eines Autos hin zur Arbeit.
Ein weiteres Problem: Mit dem Alter verträgt der Körper Alkohol immer weniger. Dies hat physiologische Ursachen. Der Anteil an Wasser im Körper sinkt im Vergleich zur Fettmasse, während die Muskelmasse abnimmt. Daher verteilt sich die gleiche Menge Alkohol auf weniger Körperflüssigkeit, was die Blutalkoholkonzentration und die Wirkung verstärkt.
Gesundheitliche Folgen und Risiken
Alkohol beeinflusst nicht nur das körperliche Wohlbefinden. „Die Mengen, die jüngere Menschen noch gut vertragen, können älteren schnell die Kontrolle wegnehmen.“ Das Resultat sind häufig Stürze und ein gesteigertes Verletzungsrisiko, aber auch Magen-Darm-Beschwerden und Flüssigkeitsverluste, die wiederum den Blutdruck negativ beeinflussen können. Ein wesentliches Risiko sind zudem Herzrhythmusstörungen.
Das Problem wird nicht einfacher, denn der Körper von älteren Menschen baut Alkohol langsamer ab. „Die Leber arbeitet träge, und der Stoffwechsel verlangsamt sich umso mehr mit dem Alter“, erklärt Wolter. Deshalb kann es lange dauern, bis man wieder nüchtern ist.
Arzneimittel können diese Problematik nochmals verkomplizieren: Senioren benötigen oft mehrere Medikamente aufgrund altersbedingter Erkrankungen, was das Risiko von Wechselwirkungen erhöht und auch die geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann.
Symptome oft nicht erkannt
Die Warnsignale eines Alkoholproblems bleiben häufig unbeachtet. Wolter erklärt, dass Symptome als Alterserscheinungen oder körperliche Erkrankungen mangelhaft gedeutet werden. So werden Verhaltenseigenheiten oft mit Demenz oder anderen Krankheiten verwechselt, weshalb in diesem Bereich oft viel übersehen wird.
Familienmitglieder und Freunde sollten sensibel für gewisse Symptome sein, die auf Alkoholprobleme hinweisen können, etwa:
- Sozialer Rückzug
- Interessenverlust
- Depressionen
- Schlafstörungen
- Nachlass der geistigen Leistungsfähigkeit
- Vernachlässigung der Körperpflege
- Unsicherheit beim Gehen, häufige Stürze
- Verletzungen und Blutergüsse
- Häufige Notarztbesuche
- Magen-Darm-Probleme
- Inkontinenz
- Mangelernährung
- Bluthochdruck
- Erhöhter Harnsäurespiegel
- Instabile Blutzuckerwerte
Sogar in Pflegeheimen stellt der Alkoholkonsum ein wachsendes Problem dar. Wolfgang Grote, Leiter des Suchthilfezentrums Schleswig, berichtet, dass viele ältere Menschen gar nicht merken, ob sie alkoholabhängig sind. Zudem ignorieren Pflegekräfte das Thema oft aus Unwissenheit oder Zeitmangel.
Empathie ist wichtig
Eine heikle Materie. Suchtexperte Wolter sagt, dass das Thema oft mit Scham behaftet ist. Wenn Angehörige ihre Betroffenen zu direkt konfrontieren, sorgt dies oft für Widerstand. Stattdessen sollte man mit Empathie und Interesse versuchen, die Betroffenen dazu zu bringen, ihren Konsum reflektieren und gegebenenfalls reduzieren zu wollen.
Übrigens: Viele denken, dass man erst dann süchtig ist, wenn Symptome deutlich sichtbar werden. Das ist jedoch nicht korrekt! Ein einfacher Fragebogen, bekannt als CAGE, kann erste Hinweise geben, ob jemand gefährdet ist.
Die vier Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden müssen:
- Hatten Sie je das Gefühl, Ihren Alkoholkonsum reduzieren zu müssen?
- Haben Sie sich je über Kritik an Ihrem Konsum geärgert?
- Fühlen Sie sich wegen Ihres Trinkens schon mal schuldig?
- Haben Sie schon einmal morgens Alkohol getrunken, um sich zu stabilisieren oder einen Kater loszuwerden?
Bei Erwachsenen bis 65 Jahren gilt: Bei zwei positiven Antworten besteht ein Verdacht auf ein Alkoholproblem, bei über 65 Jahren sogar schon bei einer einzigen positiven Antwort.
Wie viel Alkohol ist akzeptabel?
Lassen wir die Frage offen: Wie viel ist eigentlich unbedenklich? Die DHS empfiehlt, dass Menschen ab 65 Jahre nicht mehr als 10 Gramm Alkohol pro Tag konsumieren – das entspricht etwa einem kleinen Glas Bier (0.25 Liter) oder einem kleinen Glas Wein (0.1 Liter).
Parteilich schätzt Wolter diesen Grenzwert als zu hoch ein: „Es gibt keine Beweise dafür, dass geringer oder moderater Konsum vorteilhaft ist. Und die gesundheitlichen Schädigungen bei übermäßigem Konsum sind unumstritten, egal wie häufig das gegenteilige Narrativ aufkommt.”
Wenn Sie sich weiter über das Thema informieren möchten oder Hilfe suchen, besuchen Sie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: www.kenn-dein-limit.de.