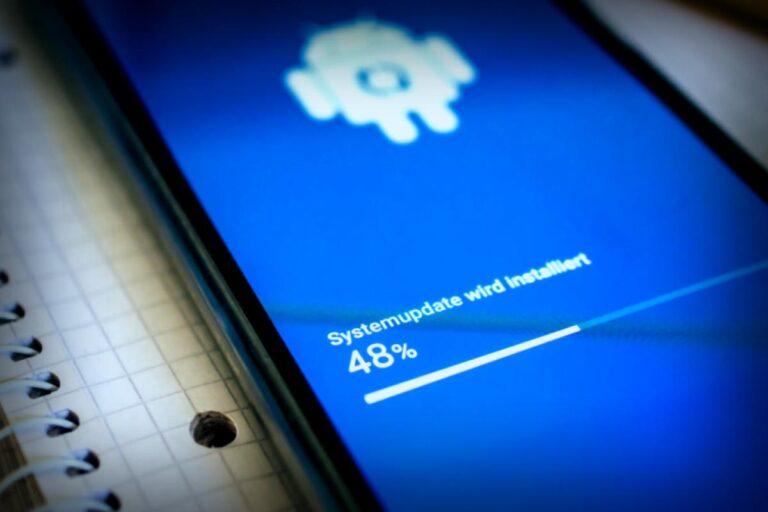Bluthochdruck zählt zu den großen unbekannten Gesundheitsrisiken unserer Zeit. Milliarden von Menschen kämpfen weltweit damit, in Deutschland ist fast jeder Dritte betroffen. Die Konsequenzen können dramatisch sein: Herzinfarkte, Schlaganfälle, Nierenschäden und sogar ein höheres Risiko für Demenz im Alter stehen auf der Liste. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet dies als eine stille Gefahr, die oft unbemerkt bleibt.
Wie kann man sich also schützen? Und wann ist der richtige Zeitpunkt, um aktiv zu werden?
Eine Langzeitstudie bietet einige wichtige Antworten. Es scheint, dass wir schon viel früher auf unseren Blutdruck achten sollten, als es die meisten annehmen. Und wo aktive Prävention versäumt wird, kann der Preis später ziemlich hoch sein.
Die CARDIA-Studie: Ein Blick auf Bluthochdruck in jungen Jahren
Um herauszufinden, wann das Risiko für Bluthochdruck tatsächlich steigt und wie effektiv man ihm vorbeugen kann, wurde die CARDIA-Studie ins Leben gerufen. Hieran haben Wissenschaftler der University of California in San Francisco lange Jahre gearbeitet.
Die Forschungsmethode war zudem unkonventionell. Statt wie zu erwarten, nur ältere Risikopatienten zu untersuchen, wurden mehr als 5100 junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahren ab Mitte der 1980er-Jahre in die Studie einbezogen – und zwar genau in einer Altersgruppe, die häufig als relativ gesund und fern von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gilt.
Warum dies so entscheidend ist? Glaubt man der Hypothese, können здесь die maßgeblichen Weichen gestellt werden. Über drei Jahrzehnte hinweg wurden zahlreiche Lebensgewohnheiten und Gesundheitsdaten der Teilnehmer erfasst. Der kritische Blutdruckpegel lag bei 130 zu 80 mmHg.
Körperliche Aktivität als Gesundheitsgarant: Bewegung zählt
Die Ergebnissen der CARDIA-Studie sind eindeutig: Menschen, die bereits in ihrer Jugend regelmäßig aktiv waren und diesen Lebensstil beibehielten, haben im späteren Leben ein nachweislich geringeres Risiko für Bluthochdruck. Ein besonders positiver Effekt zeigte sich bei Teilnehmern, die in ihren Zwanzigern viel mehr Sport gemacht haben, als die aktuellen Empfehlungen sagen.
Mindestens fünf Stunden moderate körperliche Betätigung pro Woche erwiesen sich als besonders effektiv. Zum Vergleich: Das sind etwa doppelt so viele Arbeitsstunden wie oft empfohlen werden. Oft wird nur eine Bewegung von 150 Minuten pro Woche geraten, das ist ein erheblich geringerer Wert.
„Die Studie deutet darauf hin, dass körperliche Aktivität in der Jugend – in einem größeren Ausmaß als bisher angeführt – entscheidend sein könnte, um das Risiko für Bluthochdruck im Alter zu senken“, erläutert die Studienleiterin Kirsten Bibbins-Domingo. Ein großes Plus bringt dabei die langfristige Stabilität des Bewegungslevels über die Jahre hinweg.
Doch nicht jeder kann gleich profitieren
Obwohl die Vorteile einer aktiven Lebensweise allgemein anerkannt sind, zeigte die CARDIA-Studie auch, dass nicht alle die gleichen Möglichkeiten haben, von regelmäßiger Bewegung zu profitieren. Sport ist häufig stark von äußeren Gegebenheiten abhängig. Die Fähigkeit, aktiv zu bleiben, beeinflusst oft das Lebensumfeld.
Eine interessante Entdeckung war, dass afroamerikanische Männer in der Anfangsphase der Studie aktiver waren als weiße Männer. Aber mit der Zeit hat sich das Blatt gewendet, während sich die Aktivität bei WEISSEN Männer und Frauen stabilisierte, nahm sie bei vielen afroamerikanischen Teilen ab.
Die Folgen sind erheblich: Mit 60 Jahren waren bis zu 90% der afroamerikanischen Teilnehmer von Bluthochdruck betroffen – zum Vergleich: nur 50 bis 70% in der weißen Teilnehmerschicht. Das zeigt, wie stark die gesundheitlichen Differenzen mit wachsendem Alter zunehmen.
„Sozioökonomische Faktoren, Lebensumfeld, berufliche Belastungen und familiäre Aufgaben – all das schränkt die Möglichkeit, aktiv zu sein, massiv ein“, erklärt Studienleiter Jason Nagata. Viele arbeiten in Gegenden ohne sichere Wege, Parks oder Sportmöglichkeiten und kämpfen mit Zeitmangel.
Fazit: Ein dringlicher appel an alle
Die CARDIA-Studie ist weit mehr als nur ein Wissenschaftlicher Beweis für die positiven Effekte von Bewegung. Sie ist ein entscheidender Anstoß, die derzeitigen Empfehlungen für aktive Lebensformen zu überprüfen und besser auf die Herausforderungen junger Erwachsener auszurichten. Denn viele durchlaufen Übergangsphasen nach Schule oder Universität, in denen Bewegung oft auf der Strecke bleibt – sei es Jobaufnahme, erste eigene Kinder oder ein chronischer Zeitmangel.
Der Vorschlag der Autoren? Einflussreiche Programme unterstützen die Integrität körperlicher Aktiven innerhalb alltäglicher Umgebungen, wie Schulen, Hochschulen und Firmen. Außerdem fordern sie ein medizinisches System, das körperliche Aktivitäten nicht nur empfiehlt, sondern auch von Ärzten in die routinemäßige Untersuchung für jede Patientin und Patienten einbezieht.