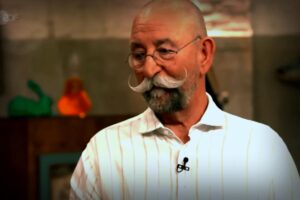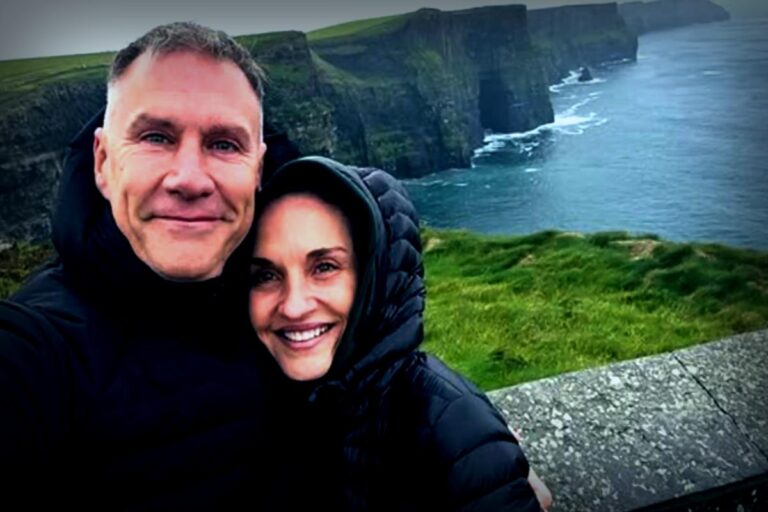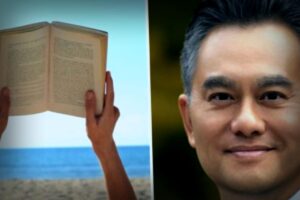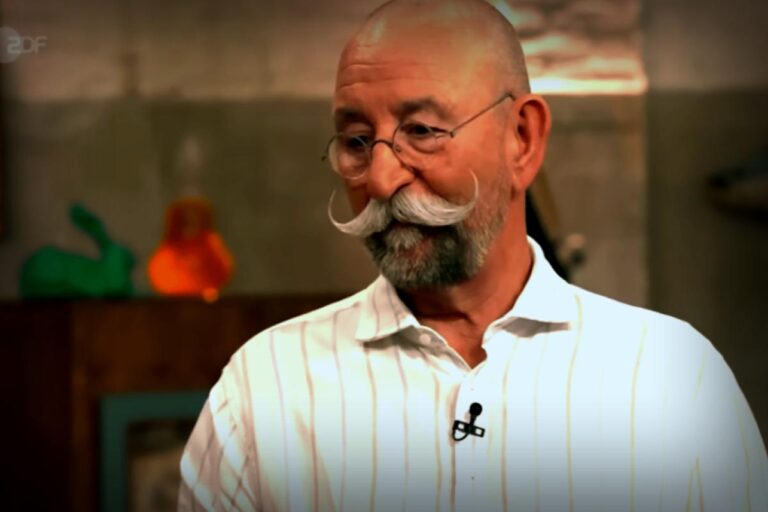Warum ständiger Fokus auf sich selbst Beziehungen schadet
Auf Instagram wird Selfcare als das Nonplusultra verkauft. Doch hinter dieser Selbstbespiegelung steckt ein Problem: Wenn wir nur an uns denken, gefährden wir unsere sozialen Kontakte und unser eigenes Glück.
Neulich sprach eine Freundin von den stressigen Vorbereitungen für eine Hochzeit: Das Kleid muss gekauft, das Hotel gebucht, und das Geschenk besorgt werden. Ein Bekannter möchte partout nicht sagen, ob er am Samstag zum Spiel kommen kann. Beide finden schnell Gründe auf Instagram: Schließlich muss man auf sich selbst hören, andere wollen ja auch schon genug Zeit mit einem verbringen. Zeit für Abgrenzung in zehn einfachen Schritten. #Selfcare.
Die Psychologin Uùber den Trend alarmiert
Gitta Jacob, eine Hamburger Psychotherapeutin, beobachtet diese Trendwelle mit Besorgnis. Hinter dem schreienden Ruf nach Selbstabgrenzung steckt oft ein emotionales Bedürfnis. In ihrem neuen Buch „Zu viel Gefühl“ erklärt sie, dass Gefühle aus unterschiedlichsten Gründen beeinflusst werden können – sei es durch Hormone,ाऱ्या Erkrankungen oder das eigene Naturell. Auch Licht, Schlaf und Bewegung können eine Rolle spielen, und natürlich unsere sozialen Kontakte.
Sensibel auf die Umwelt reagieren
Ebenfalls wichtig ist das Thema soziale Ansteckung – auch die Stimmungen unserer Mitmenschen können uns ganz leicht beeinflussen. Jacob betont: „Wenn ich mich ständig mit einem Gefühl beschäftige, werde ich es immer wieder erleben.“ In ihrer Praxis merkt sie verstärkt, dass viele Menschen ihre Emotionen gewissenhaft ergründen wollen, aber am Ende oft nicht glücklicher werden – im Gegenteil, es wird schlimmer.
„Entscheidend für unser Überleben waren äussere Gefahren – also wurden negative Gefühle evolutionär stärker in uns verankert.“ Die Psychotherapeutin erklärt, dass es tatsächlich einfacher ist, Bedrohungen zu erkennen, als Freude zu empfinden. Besonders trifft dies immer dann zu, wenn man sich permanent mit inneren Gedanken beschäftigt oder zu viel Macht den Sorgen gibt.
Negative Gefühle sind normal
Psychologen warnen, dass nicht jede Krise bedeutend genug ist, um als empfundene Krankheit behandelt zu werden. Das Glück und die Unterstützung müssen also nicht nur von Individuen kommen, sondern die Gesellschaft als Ganzes muss ihre Sichtweise ändern. „Es ist wichtig zu verstehen, dass niemand immer perfekt ist“, sagt die Polizeipsychologin Birgitta Sticher. Dies wird besonders deutlich im Studium, wenn es um Aufgaben wie die Trennung von den Eltern oder den Aufbau neuer sozialer Bindungen geht.
Wie wichtig es ist, solche Krisen richtig wahrzunehmen, hebt Sticher hervor. Dadurch kann man auch Fähigkeiten erlernen, um damit zielführend umzugehen. Jacob fügt hinzu, dass es ganz normal sei, in schwierigen Lebenslagen auch mal traurig, ängstlich oder unsicher zu fühlen. Richtig problematisch wird es erst, wenn solch ein Zustand länger anhält.
Problemsuche oder echte Notlage?
Diese Freundinnen, die nicht auf wichtige Nachrichten reagieren, oder Bekannte, die unmotiviert sind, lassen andere zurück. Jacob merkt das als sehr frustrierend an. Menschen in einer depressiven Phase sind oft einfach mehr zurückgezogen – anders als die, die aktiv entscheiden, sich nicht zu verpflichten, weil sie „spontaner“ leben wollen.
Das als „Null-Bock“-Mentalität abzutun, ist nicht gerechtfertigt. „Die meisten Menschen haben sicherlich auch gelegentlich den Wunsch, spontan etwas unternehmen zu wollen, anstatt für verpflichtende Dinge zur Kasse zu gehen. Es sind oft eben diese spontane Treffen, die für den nötigen Kontext des Glücks sorgenல்!
wenn man einmal losgegangen ist. Letztlich jedoch zeigt sich bei denen, die solch einem Impuls nicht nachgeben – beispielsweise wenn keine Zusagen gemacht werden – oft ein Verhalten, das andere als toxisch empfinden können. Doch solche Unzuverlässigkeit könnte man wirklich schmerzhaft sehen werden, befürchtet Jacob.
Freundschaft als Energiequelle
Die Vorstellung, ohne soziale Kontakte zu arbeiten, hat auch seine Schattenseiten. Ein Gedanke, den Jacob hier anführt: Aus der Forschung zur Lebensfreude ist bekannt, das die wertvollsten Augenblicke oft durch gemeinsame Erlebnisse entstehen. „Wenn man lernt, auf die Menschen in unserer Nähe zu achten, beginnt man, auch die eigene Lage anders wahrzunehmen“, führt der Entwicklungspsychologe Bruce Hood fort. Dabei muss ein Gleichgewicht zwischen Egozentrik und Offenheit bestehen.
Wohlwollende Menschen können selbst dann stark unterstützen, wenn sie nicht physisch anwesend sind. Eine Technik, die Jacob offenbar bevorzugt, ist die Methode des „Hilfs-Ichs“. Sie erläutert: Zum Beispiel, wenn ich vor einem kritischen Gespräch Bedenken habe, kann ich mich fragen: Wer würde damit gelassener umgehen? Sie beschreibt das anhand des Beispiels eines Kollegen. „Indem ich die Stärke einer anderen Person nachahme, lerne ich selbst eine konstruktive Haltung für herausfordernde Situationen hinzugewinnen“, fasst sie es zusammen.