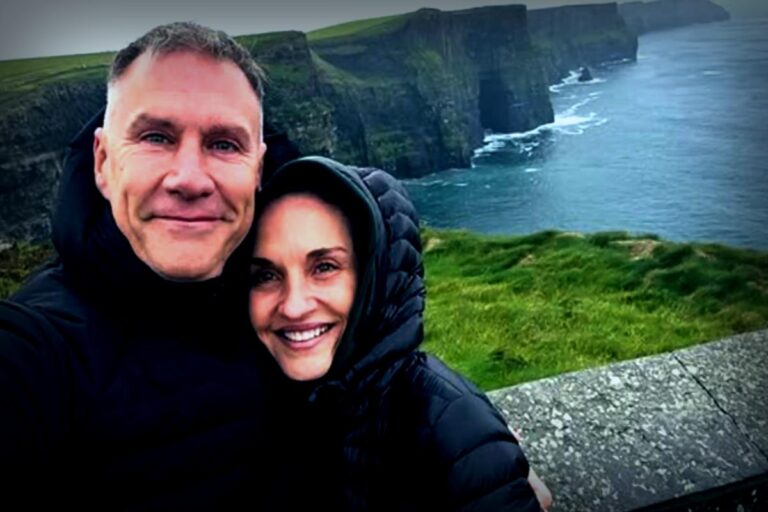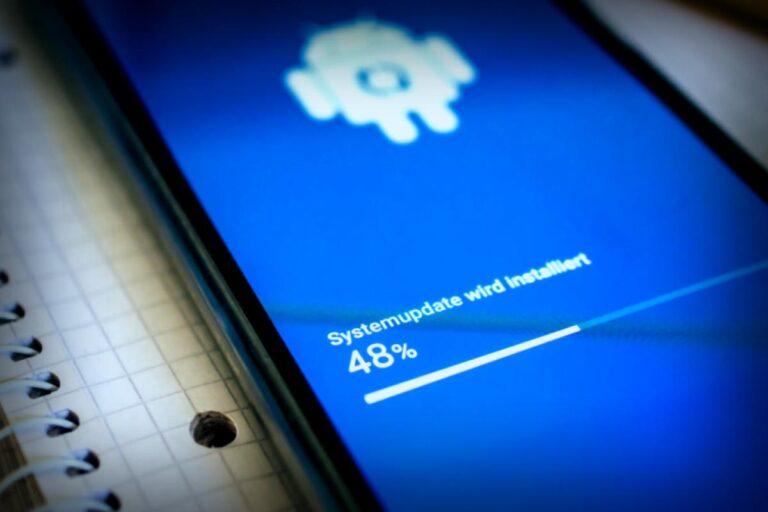Hast du dich schon mal gefragt, warum Frauen oft länger leben als Männer? Nun, eine frische Studie hat aufgedeckt, dass die Antwort mit unserem sexuelles Verhalten zusammenhängt – genauer gesagt, wie die Evolution Fürsorge anerkennt und Konkurrenz bestraft.
Langsam aber sicher drängt sich auf, dass Frauen in fast allen Kulturen eine höhere Lebenserwartung haben – im Schnitt etwa fünf Jahre mehr als Männer. Medizinische Fortschritte, bessere Ernährung und allgemein weniger körperlich belastende Arbeiten haben auf beiden Seiten den Lebensstandard erhöht, aber der Unterschied bleibt bestehen.
Eine aktuelle Studie unter der Leitung des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig gibt nun verblüffende Einblicke: Der Unterschied hat tiefere evolutionäre Ursachen und zeigt sich auch in engen Verwandten bei Tiere wieder.
Ein durchgängiges Muster im Tierreich
Forschende haben für ihre Analyse Lebensdaten aus Zoos weltweit durchforstet – was die umfangreichste Datenbank ihrer Art bis heute ist. Mehr als 1.100 Arten – von Pavianen über Fledermäuse bis hin zu Pinguinen – wurden erfasst. Und das Ergebnis? Bei circa drei Vierteln aller Säugetiere leben die Weibchen länger als die Männchen, durchschnittlich etwa zwölf Prozent mehr.
Doch bei Vögeln ist es das genaue Gegenteil: Hier haben es die Männchen besser und leben im Durchschnitt rund fünf Prozent länger. Das scheint kein Zufall zu sein, sondern folgt einem biologischen Muster, das sich im Tierreich immer wiederholt.
Die doppelte Chance für Weibchen
Ein Grund hierfür könnte in den Geschlechtschromosomen liegen. Säugetierweibchen haben zwei X-Chromosomen, wohingegen Männchen mit einem X und einem Y auskommen müssen. Wenn in einem der X-Chromosomen eine schädliche Mutation auftritt, hat das Weibchen noch ein „Backup“. Bei den Männchen jedoch haben die Defekte eine stärkere Wirkung.
Bei Vögeln jedoch sieht das anders aus: Weibchen haben zwei unterschiedliche Geschlechtschromosomen (Z und W), während Männchen zwei Identische haben (ZZ). Das verspricht den Männchen einen gewissen genetischen Vorteil und eine längere Lebensdauer.
Aber halt! Diese Erklärung passt längst nicht auf alles. Es gibt unzählige Ausnahmen – gerade bei Raubvögeln, wo die Weibchen größer und langlebiger sind. Die Theorie der Chromosomen kann also nur teilweise das Rätsel um die Lebensdauer lösen.
Der hohe Preis der Konkurrenz
Hier kommt ein weiterer, überhaupts entscheidender Faktor ins Spiel: der sexuelle Wettbewerb um Fortpflanzung. Bei Arten, in denen Männchen um die Weibchen kämpfen, haben sie oft einen hohen biologischen Preis zu zahlen. Je mehr Konkurrenzdruck, desto früher daniederlegen die Männchen. Wer immer wieder Dominanz zeigt, lebt gefährlicher. Die sexuelle Selektion wirkt wie ein evolutionäres Rennen, das zur Stärke und Risikofreudigkeit belohnt, lange Lebensdauer jedoch nicht.
In friedlicheren Arten wie einige monogame Vögel, die ihre Küken zusammen großziehen, bleiben die Lebensspannen der Geschlechter oft gleich oder die Männchen leben sogar länger, da sie weniger Energie in Wettbewerbsverhalten investieren müssen.
Ein Erbe aus alten Zeiten
Ein weiteres bemerkenswertes Muster fanden die Forscher zum Thema Fürsorge. In Tierarten, in denen ein Geschlecht die Hauptlast der Aufzucht übernimmt – oft die Säugetierweibchen –, lebt dieses merklich länger. Sinn macht das evolutionär, denn wer sich um die Nachkommen kümmert, muss eine lange Lebensspanne haben, um diese großzuziehen. Man könnte also sagen: Natur belohnt Fürsorge mit längerer Lebenszeit.
Vergleicht man Menschen mit unseren engsten Verwandten, dem Schimpansen oder dem Gorilla, zeigt sich das Bild erneut: Weibchen überleben Männchen auch hier mehrheitlich. Obwohl bei Menschen der Unterschied geringer ist, bleibt das Muster bestehen.
Die Forscher glauben abschließend, dass eine geringere geschlechtsspezifische Selektion bei Menschen – insgesamt weniger Konkurrenzdruck und mehr soziale Gleichheit – die Lebensdifferenz etwas verringert hat. Historische Daten zeigen aber, dass altersspezifische Sterblichkeit unter Müttern die Kluft verringert, wenn Gefahren beispielsweise bei der Geburt abnehmen.
Fazit: Heutige Medizin hilft, einige Unterschiede abzumildern, kann die evolutionären Vorzüge jedoch nicht beseitigen. Wir tragen noch die resultierenden Marken von einer Zeit, in der Fortpflanzung häufiger mit dem Tod als das Altern assoziiert war.
Wer sich kümmert, lebt länger
Trotz aller erneuerten Werte ist das alte Paradigma nach wie vor stark. Männer neigen eher dazu, größere Risiken einzugehen: Sei es zu hohe Geschwindigkeiten, sowie Alkohol- und Drogenkonsum – was zudem häufig zu Unfällen, Suiziden oder Herzproblemen führt. Viele Risiken sind kulturell geprägt, fügen sich aber perfekt in die Evolutionstheorie ein: Wettbewerb auszuleben kostet langfristig Leben.
Dagegen bringt Verantwortlichkeit, wie der fürsorglichen Vater für seine Kinder, statistisch eine längere Lebensdauer – möglicherweise, weil Verantwortungsgefühl die Perspektive auf das eigene Leben verändert. So zeigt sich durch moderne Lebensweisen das, was die Evolution seit Millionen Jahren offenbart: Wer vom Kämpfen auf den Schutz wechselt, gewinnt wertvolle Zeit.