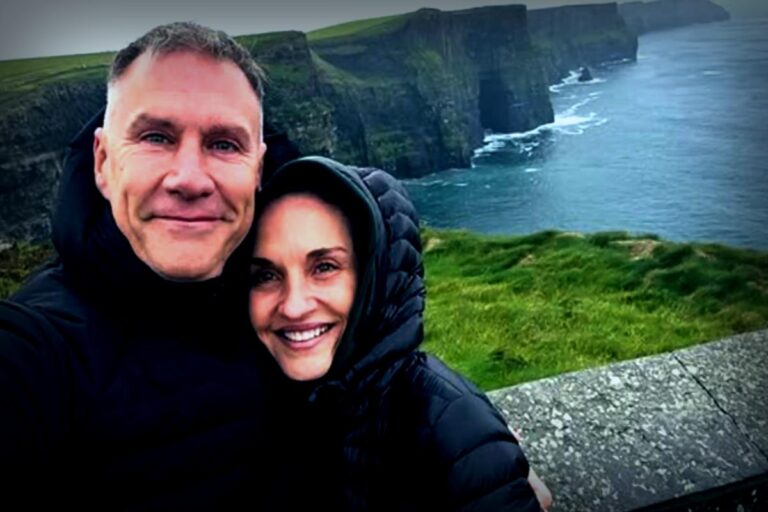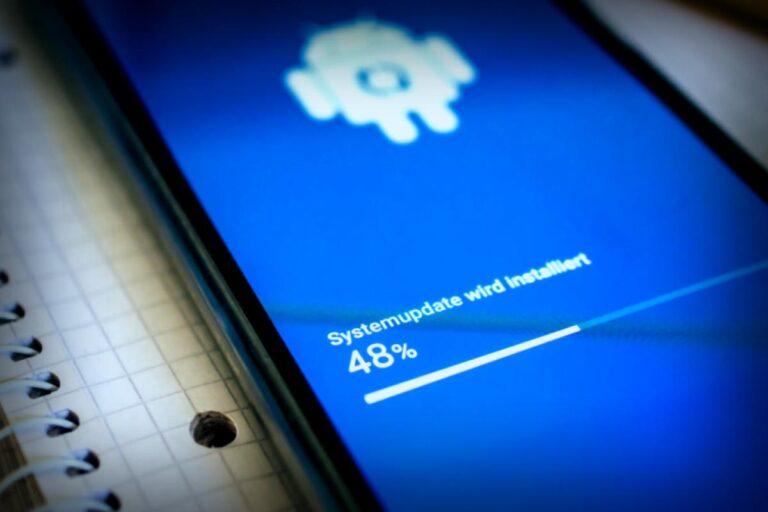Wenn man sich heute das Projekt Stuttgart 21 anschaut, kommt man nicht umhin, die Dinge neu zu bewerten. 2009, als der Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) die Finanzierung für dieses „angeblich bestens geplante“ Projekt sicherte, trat auch die Nation den „schwäbischen Wutbürgern“ gegenüber. Es wurde ein Narrativ verbreitet: In Stuttgart hätte eine grüne Skepsis des Fortschritts mit einem typischen schwäbischen Gemüt überhandgenommen, genährt von der Angst, dass die heiligen Mineralquellen versiegen könnten. Wer solchen Emotionen entgegenkommt, so die Botschaft, macht Deutschland auf der globalen Bühne zur Lachnummer. Aber es kam ganz anders: Der endlose Bau des neuen Bahnhofs und der Zufahrtsstrecken hat Deutschland international blamiert.
Die Industrialisierung und der technische Fortschritt lösen seit jeher Vorbehalte aus, oft basierend auf einer verklärten Sicht der Vergangenheit. Ob bei den Motorkutschen von Daimler oder bei den ersten Gaslaternen, das war schon immer so. Aus heutiger Sicht muss man sagen: Die Kritiker, die Grünen und die Bahnhofsgegner, hatten ein sensibles Gespür für die Probleme des Projekts. Die Kritik war berechtigt: Es stellte sich heraus, dass das Vorhaben viel zu komplex ist – und politisch kaum steuerbar. Das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen ist einfach inakzeptabel.
Das Projekt auf Eis gelegt von Ludewig
Es steht fest: Für Ingenieure ist ein neuer Bahnknoten aufregend, Architekten sehen in einem Jahrhundertbahnhof eine Chance deluxe. Aber der Entwurf, der 1997 genehmigt wurde, war technisch zu diesem Zeitpunkt einfach nicht machbar. Stuttgart und das Land Baden-Württemberg haben ein Projekt durchgezogen, das die Deutsche Bahn so nie umsetzen wollte.
Bereits 1999 legte Bahn-Chef Johannes Ludewig die Planungen nach dem Architekturwettbewerb auf Eis. Es war Günther Oettinger (CDU), der Monate später Stuttgart 21 wieder ins Spiel brachte. Seine Motive waren von Beginn an von erheblichem Legitimationsmangel geprägt. Oettinger brauchte einen politischen Erfolg nach vielgehörter Kritik an seiner Trauerrede für Hans Filbinger – das sollte der Bahnhofsumbau werden. Stuttgart selbst wollte aus den frei werdenden Gleisflächen des alten Kopfbahnhofs einen neuen Stadtteil erschaffen und verkaufte daher 2001 großflächige Eindrücke der Bahn für fast 460 Millionen Euro. Wohnungen sollten ab 2011 entstehen; heute ist damit erst 2028 zu rechnen.
Verkehrspolitisch betrachtet waren Oettingers Gründe und die Wünsche der lokalen Politiker absolut nicht stichhaltig. Nur das dritte Argument hielt: Es sei wichtig für den Standort Stuttgart, als Verkehrsknotenpunkt auf der Achse Paris-Wien-Budapest weiterhin relevant zu bleiben.
Trotz dieser offensichtlichen Mängel an Argumenten gingen die Politiker – sei es aus Unkenntnis oder Hybris – volles Risiko. Sollte das Projekt nun, wenn alles fertig wird, zeigen, dass es funktioniert, dann liegt dies nur am technischen Fortschritt, an smarter Signaltechnik und also dem Schlichtungsverfahren, das durch Grünen-Rebell Boris Palmer von Tübingen angestoßen wurde.
Missverstandene Protestbewegung
Auch die Protestbewegung wurde lange Zeit missinterpretiert. Das Zentrum des Widerstands bestand nicht aus esoterischen Käfern-Liebhabern oder halbhöhen-bourgeoisen Bürgern, sondern aus selbstbewussten Bürgern. Recherchen zeigen, dass die meisten Gegner Hausbesitzer mit akademischem Hintergrund im Alter zwischen 45 und 65 Jahren waren. Diese Menschen bejahten demokratische Werte, äußerten jedoch zu rund 80 Prozent Fundamentalzweifel bezüglich der Problemlösungskompetenzen etablierter Parteien.
Bereits vor 15 Jahren ließ sich am Hauptbahnhof erkennen, was Deutschland zunehmend beschäftigt: Das schwindende Vertrauen in etablierte Parteien. Die CDU, SPD und FDP waren stoische Unterstützer des Projekts. Heute muss der Widerstand gegen Stuttgart 21 als frühes Indiz für tiefgreifende politische Veränderungen gedeutet werden. Der Zweifel an den Volksparteien, zu Institutionen, zur Wissenschaft oder vom Missmuth geträumte Experten von Laien grenzte schon damals an einen gesamtgesellschaftlichen Umbruch.
Hinzu kommt die Entscheidung des Obersten Verwaltungsgerichts des Landes, dass nur die Bahn für die Mehrkosten in Höhe von sieben Milliarden Euro aufkommen muss. Diese Problematik wurde im Finanzierungsvertrag von 2009 absichtlich vage in einer „Sprechklausel“ festgehalten, weil die Bahn einer vollständigen Übernahme des Kostenrisikos niemals zugestimmt hätte.