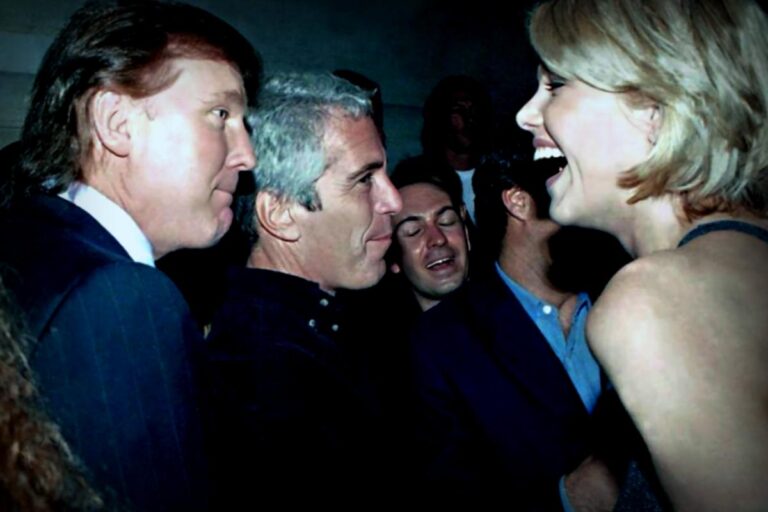In der Diskussion um das Verbrennerverbot wird kostbare Zeit verspielt.
Markante Wegweiser: IAA – es ist klar, dass die Politik verrückt nach Autos ist. Kanzler Friedrich Merz versucht, Orientierung beim Autogipfel zu finden, während CSU-Chef Markus Söder mit seinen eigenen Plänen Aufmerksamkeit erheischt. Gleichzeitig bringt SPD-Finanzminister Lars Klingbeil E-Förderungen ins Spiel.
Aber während wir hier über Fristen, Ladestationen und Bürokratie diskutieren, hat woanders bereits die Zukunft an Fahrt aufgenommen – in China. Das Land verfolgt einen klaren Plan: Bis 2035 sollen Elektrofahrzeuge die Mehrheit der Neuwagen ausmachen, egal, ob sie batteriebetrieben, plug-in-hybrid oder mit Verbrennungsmotor betrieben werden.
Peking zieht konsequent seinen industriepolitischen Kurs durch, während Deutschland und Europa so wirken, als würden sie immer noch die Regeln des Spiels festlegen, obwohl das Rennen bereits begonnen hat.
Umso riskanter ist die Haltung von Söder, der das gesamte EU-Verbot für Verbrenner bis 2035 in Frage stellt. Das suggeriert, dass Verbrenner mit E-Fuels vielleicht doch noch Zukunfschancen haben. Auch wenn das für einige klassischen Fahrzeuge zutrifft, zeigt Chinas Zehnjahresplan, dass der Weg zur Elektromobilität nahezu unumgänglich ist.
Die schädlichen Auswirkungen der Debatten über das Verbrennerverbot
Diskussionen über die Streichung des Verbrennerverbots sind irreführende Debatten. Hersteller wie VW, Mercedes und BMW haben Milliarden in den Umbruch investiert, viele Werke werden neu ausgerichtet oder haben das bereits getan. Was wäre der Plan – alles nochmal rückgängig machen? Der Preis dafür wäre enorm: Nicht nur die derzeit diskutierten 35.000 Jobs von VW stehen auf der Kippe, sondern Hunderttausende, so sagen Beratungen.
Trotz aller Kritik an der späten Elektrokompetenz sollten wir uns bewusst machen, was wir in Deutschland bereits erreicht haben. Die neuesten Modelle auf der IAA zeigen, dass BMW, Mercedes und VW technologisch durchaus Schritt halten können.
Ladegeschwindigkeit, Software, Infotainment – all das hat sich im Vergleich zu vor einigen Jahren stark verbessert. Dazu kommen namhafte Marken und ein bewährtes Vertriebsnetz, auf das die Kunden vertrauen können.
Doch der wesentliche Kritikpunkt bleibt: Die Preise für Elektroautos aus Europa sind einfach zu hoch. Und das wird voraussichtlich auch so bleiben. Hier sind politische Lösungen gefragt. Beispielsweise:
- Europäisch einheitliche und wettbewerbsfähige Strompreise für die Industrie, um mehr Batteriefabriken ansiedeln und die wichtigsten Bauteile lokal herstellen zu können.
- Ein Genehmigungsverfahren, das dringend benötigte Schlüsselprojekte – wie die Ladeinfrastruktur – in maximal zwölf Monaten umsetzt.
- Eine Harmonisierung der Preise für Ladestrom an öffentlichen E-Tankstellen, die geradezu willkürlich schwanken.
Über Fristen, kaufkraft und Infrastruktur kann man reden. Doch das Ziel muss klar sein: Der Weg zur Elektromobilität führt langfristig an keinem vorbei. Seltsam, dass dieser Satz noch im Jahr 2025 immer wieder betont werden muss. Anderswo ist dies offenbar eine selbstverständliche Konsequenz.