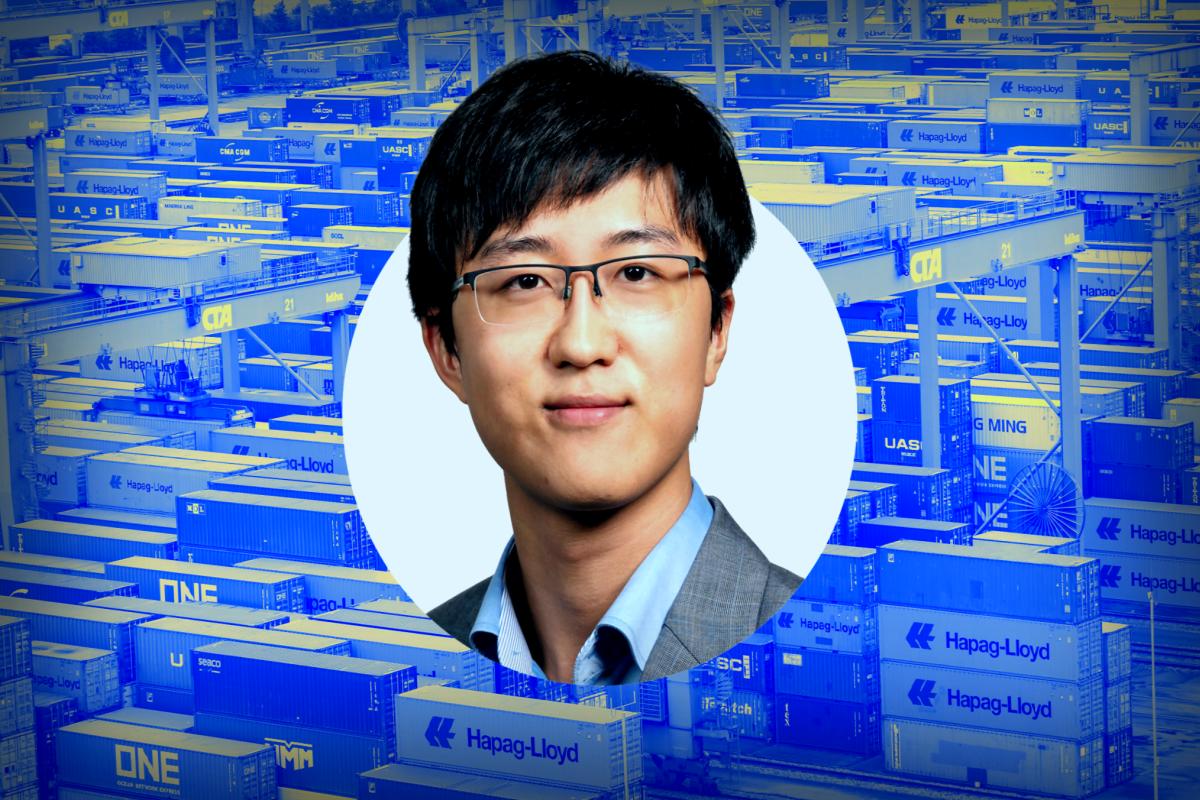Die Zeiten, in denen „Made in Germany“ als unbestrittener Vorteil galt, scheinen vorbei zu sein. Das erklärt Kevin Chen, ein Importeur aus Shanghai und Braunschweig, in seinem Kommentar zur neuen Realität im Handel mit China.
In den letzten Wochen haben viele Stimmen gewarnt, dass das deutsche Geschäftsmodell ernsthaft in der Krise steckt. Der Chefökonomen des Handelsblattes, Bert Rürup, machte in seiner Analyse klar, dass der Rückgang deutscher Exporte nach China – um stolze 25 Prozent in nur fünf Jahren – auf grundlegende Mängel in der Wettbewerbsfähigkeit zurückzuführen ist.
Für uns als Importunternehmen stellt sich das nicht nur theoretisch dar: Wir erleben diesen Druck täglich durch Kundenfeedback, Preiserhöhungen und Auswirkungen auf unser Auftragsvolumen. Vor einem Jahrzehnt war das Label „Made in Germany“ für chinesische Kunden eine Selbstverständlichkeit und ein handfestes Verkaufsargument.
Doch aktuell hören wir häufig Klagen über lange Lieferzeiten, schwer erreichbaren Kundenservice und betriebene Reklamationen. Immer mehr chinesische Käufer zeigen zudem auf alternativ funktionierende Produkte von heimischen Herstellern. Zwar fuchtelten früher die Kunden nur mit einem möglichen Wechsel in den Verhandlungen, heute setzen sie das ernsthaft um.
Das hat zwei Grundursachen:
- Schrumpfender technischer Vorteil: Jeder neue Fortschritt, den Unternehmen aus China machen, führt dazu, dass die Zahlungsbereitschaft für unsere teuren Importsachen sinkt. Somit lässt sich die beeindruckende Innovationskraft des deutschen Mittelstands nicht leugnen, aber Chinas Geschwindigkeit bei der Entwicklung lokaler Produktanpassungen schmilzt diesen Vorsprung dramatisch.
- Steigende Kosten in Deutschland: Preissteigerungen bei Energie, Personal und Material zwingen dazu, die Preise für „Made in Germany“ höher zu setzen, was sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirkt.
Heute sind Preisvergleiche mit lokalen Anbietern die Regel
Mit der sinkenden Zahlungsbereitschaft in China und gleichzeitig steigenden Preisen in Deutschland wird die Nachfrage nach deutschen Produkten immer mehr in Frage gestellt. Früher war ein Preisvergleich mit lokalen Alternativen selten, jetzt gehört er zur Alltagsrealität – auch weil der Importgeschäft und Binnenmarkt früher klarer getrennt waren.
Der Wandel wirkt sich nicht nur auf deutsche Hersteller aus, sondern notably auch auf Distributoren und Handelsunternehmen, die über lange Zeit als verlängerter Arm deutscher Firmen in China agierten.
In dieser neuen Marktlandschaft fällt es speziellen Distributionsstrukturen unglaublich schwer, grundlegende Serviceleistungen für Importprodukte kosteneffizient anzubieten. Stellen wie Lagerhaltung oder technischer Support sind oft unwirtschaftlich, was den Abstand zu lokalen Anbietern vergrößert und den Umstieg auf diese Alternativen beschleunigt.
Politisch gefördert und wirtschaftlich vorangetrieben stellt erleben wir somit eine rasche Substitution deutscher Importwaren durch chinesische Preise, was für den deutschen Mittelstand die größte Herausforderung im Chinageschäft darstellt.
Eine kritische Maßnahme vieler Unternehmen:
Die naheliegendste Lösung für viele managerreicher Konzerne ist das Verlagerung von Produktion in Richtung China, die Entwicklung lokaler Aufträge und gewisse strategische Effizienzen flott zu gestalten. Schlagworte wie „In China für China“ stehen im Raum. Unternehmen aus Deutschland stellen fast umgehend fest, dass Materialien ihrer Fertigungen zunehmend durch chinesische Produkte ersetzt werden.
Die Atmosphäre von „Domestic Substitution“ und möglicher „Involution“ hat ubiquitär Auswirkungen, insofern bleibt kaum eine Branche unberührt. Dieser spezifische langwierig Wettbewerb betrifft nicht nur die Preisgewinne, sondern auch weiter bestehende Marktanomalien.
Mit einem pragmatischen Ansatz betreten Firmen einen Mittelweg. Gestreckte Verteilungsketten werden verkürzt, und entscheidende Aufgabengebinde bleiben beim Anbieter selbst. Die Überlegung zur Behandlung von Schulungen aus Deutschland wird somit ebenfalls bezogen, und bewusst offene Diskussion gefördert. Das erfordert Mut, sowohl aufachement Arbeitgeber-Seite, wie auch Einsicht in die Aufgabe selbst.
Kevin Chen ist im Einkauf von Silkroad 24 ansässig. Er leitet den Vertrieb von Lösungen im Bereich Automatisierungs- und Messtechnik zwischen Europa und China.