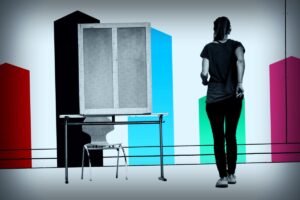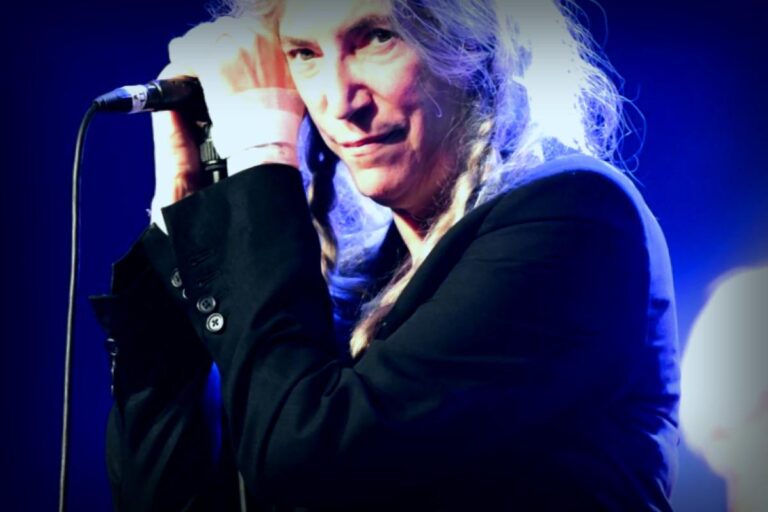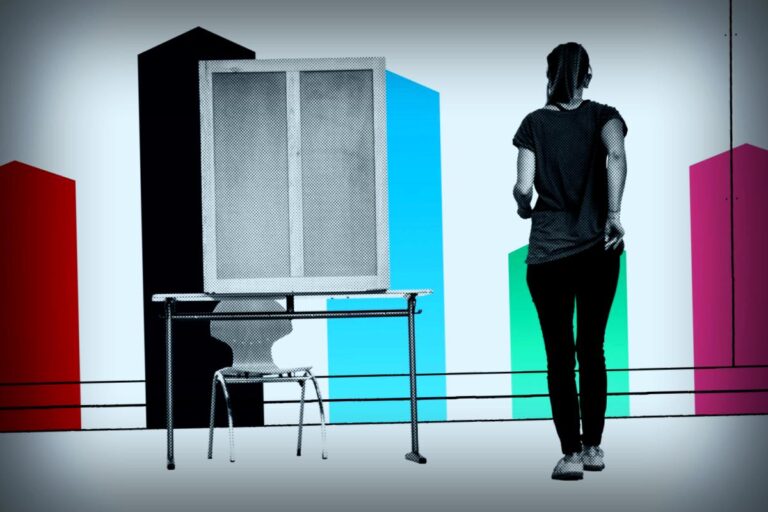Friedrich Merz ist seit Mai 2025 an der Spitze der Bundesregierung und verfolgt eine technologieoffene Haltung in der Klimapolitik. Dabei lehnt er starre Verbote ab und setzt mehr auf Marktmechanismen, um den Klimawandel einzudämmen. Doch führende Wissenschaftler sind skeptisch: Ihrer Meinung nach könnten seine Programme in Verbindung mit den derzeitigen Kürzungen im Budget den Fortschritt der Energiewende erheblich behindern. Unter den Stimmen der Kritik steht unter anderem Prof. Dr. Andreas Bett, Direktor des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg.
Merz: Ein Drahtseilakt zwischen Klimapolitik und wirtschaftlichen Interessen
Insbesondere die Einsparungen im Klima- und Transformationsfonds (KTF) stehen in der Schusslinie der Kritik. Der KTF ist seit Jahren eine essenzielle Quelle für die Förderung von Energie- und Klimaforschung. Zwar wird das Budget dieses Fonds im Jahr 2025 auf 100 Milliarden Euro erhöht, jedoch fließt ein großer Teil dieser Gelder in die Senkung von Strompreisen und Entlastungen der Netzentgelte – statt in die nötige Forschung und Entwicklung zur Bekämpfung des Klimawandels. Während der allgemeine Forschungsetat für 2025 stabil bleibt, sinken die Mittel für die Energieforschung erheblich.
Das Fraunhofer ISE erhält damit etwa 15 Millionen Euro weniger pro Jahr im Vergleich zu früheren Jahren. „Besonders betroffen sind die Mittel für Batterieforschung und Wasserstoffprojekte“, erklärt Bett in einem Interview. Die negativen Auswirkungen dieser Kürzungen werden vor allem bei Projekten sichtbar, die über mehrere Jahre laufen. Ein markanter Rückgang könnte bedeuten, dass wichtige Forschungsansätze sowie Fachkräfte verloren gehen werden. Die Kürzungen stehen konträr zu den Investitionsplänen der Automobilindustrie, die in den nächsten vier Jahren rund 320 Milliarden Euro in nachhaltige Mobilität stecken möchte; ohne staatliche Innovationsförderung könnte dieses Potenzial schwerer ausgeschöpft werden.
Laut Bett sind die Auswirkungen der Kürzungen bis 2024 noch nicht spürbar, da die meisten Forschungsprojekte über zwei oder drei Jahre finanziert werden. Doch die bitteren Folgen werden erst in den kommenden Jahren richtig sichtbar werden.
„Der Klimawandel ist das größte globale Problem“
Obwohl Merz zu den Klimazielen, wie der angestrebten Klimaneutralität bis 2045, steht, bleibt der Koalitionsvertrag in Bezug auf konkrete Maßnahmen vage und setzt auf eine technologieoffene Haltung und verträgliche Wirtschaftsbedingungen, ohne starre Ausstiegsdaten für bestimmte Technologien festzulegen.
Dabei wird die Skepsis gegenüber dem zügigen Ausbau von Wind- und Solarenergie und den strengen Vorgaben zum Austausch von Heizsystemen vermerkt, was die Energiewende stark ausbremsen könnte. „In Anbetracht der aktuellen globalen Krisen– sei es der Krieg, Zollfragen oder die Situation im Nahen Osten – dürfen wir nicht vergessen, dass der Klimawandel das drängendste Problem bleibt“. Bett appelliert an die Politik, das Thema Klimawandel fest im Kopf zu halten und den Fokus darauf nicht zu verlieren.
Versorgungssicherheit: Ist die Batterie der Schlüssel?
Die sogenannte Dunkelflaute – Phasen, in denen weder Wind noch Sonnenstrom verfügbar sind – sieht Bett entspannt. Er verweist auf den Ausbau von Batteriespeichern und die Entwicklung eines gut vernetzten, europäischen Stromsystems sowie Reservekraftwerke, die in Zukunft auch mit Wasserstoff betrieben werden können.
Kurzfristig sind die Batteriespeicher entscheidend, um die tagtäglichen Schwankungen der Solarenergie abz rn. Für längere Zeiträume könnten jedoch gas- oder wasserstoffgestützte Kraftwerke effizienter sein. Die aktuellen Szenarien des Fraunhofer ISE zeigen, dass für eine vollständige Dekarbonisierung bis 2045 nicht nur der Aufbau erneuerbarer Energien, sondern auch eine gut angelegte Speicherinfrastruktur unbedingt erforderlich ist, die sowohl Kurzzeitspeicher als auch saisonale und grenzüberschreitende Netzwerke berücksichtigt.
Wissenschaft vs. Politik: Eine langsame Umsetzung
Ein weiters Ärgernis: die langsame Umsetzung von wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen in politische Maßnahmen. Während im Verteidigungsbereich Gelder schnell mobilisiert werden, zieht sich das beim Klimaschutz in die Länge. Bett kritisiert dieses Zögern als umso problematischer, wenn es um die Einhaltung der selbst gesteckten Klimaziele bis 2045 geht.
Außerdem gibt es teils aufgeheizte Debatten, die oft von Fakten entfernt sind. Bett kritisiert, dass die hitzige Diskussion über Wärmepumpen den Markthochlauf stark behindern kann, da hier Schlagworte und politische Kampagnen den öffentlichen Eindruck prägen. „Das macht es mir wirklich schwer“, erklärt der Energieexperte, „aber aufgegeben habe ich dennoch nicht!“ Ähnlich verhält es sich mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), das Merz schon kampagnenartig gegen seine politischen Gegner genutzt hat. Derartige Polemik hat seiner Meinung nach gravierende negative Folgen.
Ausblick: Der Weg nach vorne
Trotz aller Hürden ist Bett überzeugt, dass wir die Energiewende schaffen können – wenn sowohl die Politik als auch die Gesellschaft entschlossen handeln. Besonders in Zeiten internationaler Krisen ist es wichtig, den Klimaschutz nicht aus den Augen zu verlieren, da die Kosten des Zögerns letztlich weit höher ansteigen könnten als die dringend erforderlichen Investitionen.
Zum politischen Handeln gehört es, dass auch eine technologieoffene Vision klare Ausbauziele und verlässliche Finanzierungszusagen benötigt, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Von wirtschaftlicher Seite aus erfordert es, dass der Investitionswillen der Industrie durch transparente Rahmenbedingungen gestärkt wird. Und der wissenschaftliche Bereich muss sicherstellen, dass aktuelle Forschungsergebnisse zeitnah in praktische Maßnahmen münden.
Quellen: Table.Media; Fraunhofer-Gesellschaft