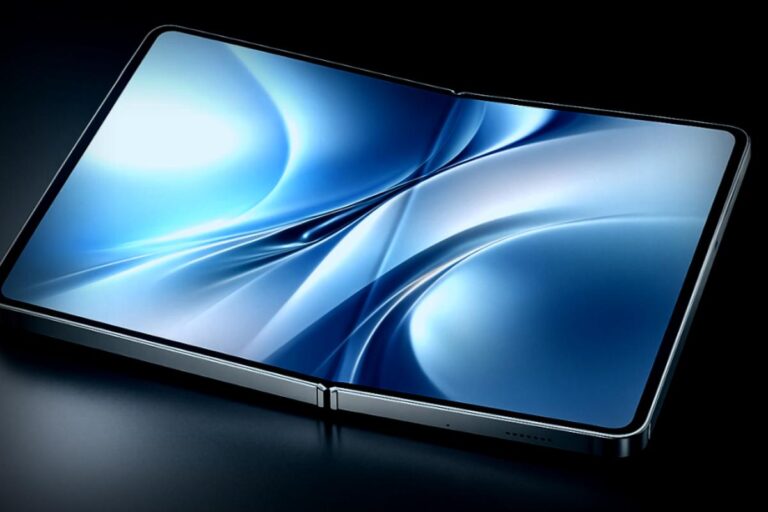Die E-Mobilität in Deutschland steckt fest. Bis 2025 wird erwartet, dass mehr als 80 Prozent der Neuwagen weiterhin mit Verbrennungsmotoren fahren. Aktuell besteht der Anteil von Elektroautos am Gesamtbestand nur aus etwa drei Prozent. Ein neuer Artikel im Spiegel macht hierfür vor allem die konservative Denkweise der deutschen Autofahrer verantwortlich.
Im Bericht wird behauptet, die Vorliebe für Verbrenner sei tief in der deutschen Identität verwurzelt und kñezet das Lebensgefühl von Generationen. Doch ist diese Einschätzung nicht zu kurz gegriffen? Wurden nicht ebenfalls Kunden durch den plötzlichen Stopp der Förderung, unklare politische Diskussionen über das Aus für Verbrenner und das Fehlen attraktiver E-Auto-Modelle verunsichert? Experten betonen, dass der Widerstand gegen Elektroautos weniger mit Mentalität als vielmehr mit strukturellen Problemen zu tun hat.
Trotz erheblicher Investitionen in die Elektromobilität und technischer Fortschritte bleibt der Elektromarkt in Deutschland hinter den Prognosen zurück. Um die angestrebten 15 Millionen E-Fahrzeuge bis 2030 zu erreichen, muss Deutschland noch gehörig aufholen – aktuell sind nur etwa 1,65 Millionen zugelassen. Die Zahl der verfügbaren Elektrofahrzeuge steigt zwar, aber aufgrund mangelnder Akzeptanz bevorzugen über vier von fünf Neuwagenkäufern immer noch Verbrenner.
Die Ladeinfrastruktur hat sich zwar deutlich verbessert, mit rund 180.000 Ladepunkten, jedoch stagnieren die Zulassungszahlen. Interessanterweise stellt man fest, dass in manchen Städten, in denen Elektroautos produziert werden, wie Zwickau, der Anteil der E-Autos am Fuhrpark bei weniger als zwei Prozent liegt. Mehrere Hersteller wie Porsche, BMW und Mercedes reagieren mit neuen Modellen für Verbrenner.
Die Spiegel-Analyse führt die Stagnation im E-Auto-Markt zu großen Teilen auf kulturelle und psychologische Gründe zurück. Der verhasste Begriff „Verbrennerverbot“ hat breiten Widerstand ausgelöst, das Elektroauto wird als „Verzichtsmobil“ wahrgenommen. Wie es der frühere VW-Chef Herbert Diess im Spiegel formulierte: „Wir können nichts verkaufen, was die Deutschen nicht haben wollen.“
Der Psychologe Claus-Christian Carbon spricht sogar von einer „Selbstvernichtung“ der deutschen Elektromobilität, da viele den technischen Wandel als Bedrohung ansehen. Dies wird durch das Phänomen des Status-quo-Bias verdeutlicht, das besagt, dass Menschen oft lieber am Bekannten festhalten, selbst wenn das Alte objektive Nachteile hat. Doch sind diese psychologischen Faktoren allein ausreichend, um die Problematik zu verstehen?
Während der Spiegel überwiegend kulturelle Aspekte in den Vordergrund stellt, betonen Branchenexperten, dass die Ursachen der schleppenden E-Mobilität vielschichtiger sind. „Die Menschen adaptieren nur, wenn ihnen dies angenehm empfunden wird“, erklärt Beatrix Keim, Direktorin des CAR-Instituts in Duisburg. Viele sind emotional mit dem Verbrenner verbunden, besonders in Ländern mit einer starken Automobilkultur. Sie gibt zu bedenken, dass die E-Mobilität derzeit nicht als bequem angesehen wird. auch gab es in der Kommunikation bisher zu viele theoretische Erläuterungen und kein klärendes „Warum“. Sie sieht den Kunden als dritten maßgeblichen Faktor für die E-Auto-Nachfrage, hinter der Industrie und der Politik. Diese muss vor allem attraktive, bezahlbare Modelle anbieten und den Wandel klar kommunizieren. Erst dann könnte das Käuferverhalten besser eingeschätzt werden. Keim thematisiert die „Trotzreaktion“ auf das abrupte Ende der Förderung durch die Ampelkoalition und stellt fest, dass Vorurteile erhalten bleiben, solange es an klaren Informationen mangelt.
Frank Schwope, Lehrbeauftragter für Automotive Management an der FHM Köln, anerkennt ebenfalls, dass der Glaube, eine konservative Haltung wäre ausschlaggebend, zu einfach sei. Die Zurückhaltung beim Kauf kann verschiedene Ursachen haben: „Politik hin und her, begrenzte Modelauswahl, fehlende Ladeinfrastruktur, lange Ladezeiten und keine Möglichkeiten, privat zu laden.“ Rationalität spielt eine entscheidende Rolle, erklärt er. „Werden Preis und Technologie angemessen, werden die meisten auf E-Autos umsteigen.“ Das zeigt auch einen positiven Trend bei den Verkaufszahlen – im Oktober lag der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bei 21 Prozent, Hinzu kamen 40,6 Prozent Hybride.
Stefan Reindl, Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA), relativiert dies noch weiter. Er sieht die Analyse im Spiegel lediglich als einen Teil der Wahrheit. Hauptverantwortlich ist für ihn die Politik, die durch „widersprüchliche Signale zum Aus der Verbrenner und den abrupten Förderstop“ das Vertrauen in die E-Mobilität untergräbt. Er kritisiert zudem, dass die Autoindustrie den Wandel lange verzögert hat und erst spät damit begann, bezahlbare Modelle zu bieten. Für ihn stellen Politik und Industrie die vermeintlich konservative Haltung der Verbraucher als eine besonders einfache Ausrede dar, um eigene Versäumnisse zu vertuschen. Seiner Meinung nach ist die politische Rahmengebung der größte Bremsfaktor, gefolgt von der Infrastruktur, die Entwicklung der Industrie und erst danach kommt die Einstellung der Verbraucher.
Ferdinand Dudenhöffers Einschätzung unterstützt diese Sichtweise: Die gemeinsam genutzte Vorstellung von „konservativen Autofahrern“ als Hauptproblem greift zu kurz. Technische Nachteile zuvor eingeführter E-Modelle, etwa der ID-Serie von Volkswagen, sowie höhere Vertrauensanforderungen bei Preisen über 50.000 Euro erschweren die Akzeptanz. Problematiken wie Reichweite, Batterielanglebigkeit, Sicherheit und natürlich der Preis sind entscheidende Faktoren.
Matthias Schmidt von Schmidt Automotive Research betrachtet schließlich die Thematik in einem kulturellen Kontext. Er zieht Parallelen zur starken Bindung der Deutschen an Verbrenner mit der geschätzten Kultur der Schweizer für mechanische Uhren: „Es wäre illusorisch zu erwarten, dass die Schweizer über Nacht ihre analogen Uhren gegen digitale eintauschen“, erklärt er. Ebenso fest ist die Verbindung der Deutschen zur Automobilindustrie verwurzelt. Ein Wandel ist jedoch denkbar, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Schmidt merkt an, dass sinkende Preise das Marktbild plötzlich ändern können. Die Deutschen würden Rabatte lieben, verweist er auf die hohe Anzahl von Aldi und Lidl-Filialen in Deutschland.
Die Millerung und Aufstellung der Branchenexperten ist klar: Allein die konservativen Autofahrer sind nicht das zugrunde liegende Problem der Elektromobilität. Die Kaufzurückhaltung der Kunden ist vorhanden, vor allem als Antwort auf unklare politische Signale, technologisch inakzeptable Angebote und Fragen der Alltagstauglichkeit. Wenn Preis, Qualität und Perspektive ermittelt werden, könnte der Markt möglicherweise kippen. Der Wandel beginnt nicht beim Verbraucher, sondern bei denen, die Fernandes.Auto anbieten.
Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns gerne! [email protected]