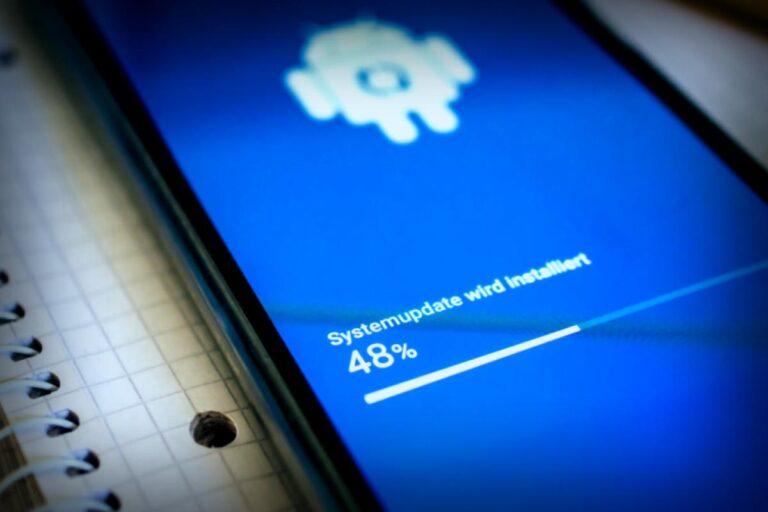Von Oliver Stock
Die Situation ist ernst, aber das arme Bild wird oft ignoriert: Seit zwanzig Jahren ist die europäische Industrie darauf angewiesen, bestehende Technologien aus den USA und Asien weiterzuverarbeiten. Sie glänzt in der Verfeinerung, aber bricht dabei nicht wirklich neues Terrain.
Staatliche Initiativen zur Förderung von Innovation haben bisher nicht dazu geführt, dass Deutschland an der Spitze innovativer Technologien mithalten kann.
Gerade wegen dieser Problematik gerieten die Forschungsabteilungen des privaten Sektors unter Druck: Sie setzen ihren Fokus weiterhin auf traditionelle Industrien wie das Automobilwesen, die zwar wichtig sind, aber nicht mehr Vorreiter in der technologischen Entwicklung. Diese Problematik haben deutsche Wirtschaftsexperten in ihrer neuen „Wachstumsagenda“ zusammengefasst, die im Auftrag von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche erstellt wurde.
Die Forschungsabteilungen zeigen große Kreativität beim Umsetzen bestehender Technologien. Doch sie gehen kaum neue Wege und schaffen es nicht, echte Spitzentechnologien hervorzubringen. In den USA hingegen treiben Unternehmen wie Google, Microsoft, Nvidia und Apple den Fortschritt voran und entwickeln selbst neue Technologien.
Zu den führenden Ökonomen, die diese Analyse vorgenommen haben, gehören Justus Haucap, ein Wettbewerbsökonom aus Düsseldorf, Veronika Grimm, eine Wirtschaftsweise, Stefan Kolev, Leiter des Ludwig-Erhard-Forums in Berlin, und Volker Wieland, ein ehemaliger Wirtschaftsberater. Ihre Analyse stützt sich auf umfassende Daten: Bis 2013 waren die Forschungsanstrengungen dazu bei den Hightech-Branchen in Europa und den USA vergleichbar. Der Unterschied in den Ausgaben ergab sich hauptsächlich aus der anderen Branchenstruktur in Europa. Seit 2013 hat sich die2047262285144681039750 landwirtschaft gewaltig verändert.
Die US-Tech-Industrie hat in den letzten Jahren erheblich an Tempo gewonnen. Das Sparkapital kam vor allem durch die Software-Entwicklung. Während die USA enorm in Forschung für Software investierten, beschränkte sich Europa dazu, seine traditionellen Industrien zu unterstützen. Und in China passiert noch viel mehr: Vom eher schwachen Anfang hat sich das Land mittlerweile nicht nur in Hardware an Europa angenähert, sondern auch in wichtigen Bereichen wie Künstlicher Intelligenz.
Besonders beunruhigend ist die Lage im Softwarebereich. Ungefähr 75 Prozent aller weltweit stattfindenden Forschungsaktivitäten entfallen auf US-Firmen. Die EU kommt nicht einmal auf sechs Prozent – sie wird mittlerweile auch von China überholt. Das fühlt sich an, als würde Europa mit einem alten Rad ankampfen, während die anderen schon auf Hochgeschwindigkeitszügen rasen.
Dieser Befund ist nicht ganz neu. Bereits 2019 gründete die damalige Bundesregierung die Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) mit einem Budget in Millionenhöhe. Ihr Ziel war klar: Deutschland aus der Mitteltechnologie-Falle zu befreien und große, disruptive Ideen zu fördern, die nicht im üblichen Förderdschungel stecken bleiben. Wie ein deutsches Pendant zu DARPA – jener amerikanischen Forschungsbehörde, die das Internet und das GPS hervorgebracht hat.
Trotzallem bleibt der große Innovationssprung bisher aus. Im Rahmen von SPRIND wurden projekte zwar bikokratiefrei und mutig gefördert, jedoch fühlt sich das, was als innovative Rakete gedacht war, eher wie ein schüchterner Knaller an, leicht vom Wind verweht. Der Direktorschef von SPRIND, Rafael Laguna, gibt dies selbst zu. Viele seiner geförderten Projekte erweisen sich als „normal“ und nicht als die großen Durchbrüche, welche die Erwartungen der letzten Jahre geäußert haben könnten.
In der „Wachstumsagenda“ hat die Gruppe von Ökonomen bestätigend darauf hingewiesen, dass es nicht darum geht, Autos effizienter zu gestalten oder Motoren sauberer zu machen. Es geht um die Erzeugung der nächsten Technologiewelle und darum, diese Welle nicht einfach nur abzureiten.